2. Sozialethische Orientierung
Ü B E R B L I C K
Weltweit verlassen Menschen ihr Land, fliehen oder wandern aus. Nicht immer ist es einfach, zwischen Flucht und Migration zu unterscheiden. Flüchtlinge sind jedoch besonders schutzbedürftig…
2.1 Länderspiel der Herzen
Ü B E R B L I C K
Deutscher, Asiat, Pfarrer. Daniel Cham Jung weiß, was Fremdsein im eigenen Land heißt. Als Fußballfan träumt er davon, dass bald ein Koreaner für Deutschland Tore schießt…
Zwei Herzen schlagen in Daniels Brust, wenn er über Heimat spricht. Der Deutsch-Koreaner ist evangelischer Pfarrer im Kirchenkreis Schwelm. Er wurde 1984 in Castrop-Rauxel geboren und ist in Dortmund aufgewachsen, war aber lange Zeit hin- und hergerissen, wo eigentlich seine Heimat ist.
Das Ruhrgebietskind asiatischer Abstammung ist mit Deutschland fest verbunden. Seine Eltern leben seit Jahrzehnten in Dortmund, fühlen sich „voll integriert“ und wollen hier beerdigt werden. Zuerst war seine Mutter 1967 als Krankenschwester nach Deutschland gekommen. Sein Vater verließ Mitte der 1970er Jahre sein Heimatland Korea, um in Deutschland im Bergbau zu arbeiten.
Daniel Cham Jung und seine Frau, die ebenfalls koreanische Eltern hat, verstehen sich als Vertreter eines künftigen Deutschlands, das interkulturell immer vielfältiger wird. Umso mehr verletze es ihn, wenn jemand sagt: „Du bist kein Deutscher“ oder „Deutschland ist nicht Deine Heimat“. Als Asiat fällt der Pfarrer in seiner Gemeinde auf. „Zur Zeit bin ich ein Unikum“, weiß er. Viele Menschen können beim Erstkontakt am Telefon nicht erkennen, dass er aus einer Familie mit Migrationshintergrund stammt. Sein Aussehen kann er jedoch nicht verbergen und erlebt dann oft Überraschung als Reaktion. Dabei müsse er sich häufig erklären. Auch freundliches Nachfragen könne mal „nerven“ und als Angriff verstanden werden. „Ausländersein“ sei eben keine Selbstverständlichkeit in Deutschland.
Jung versteht sich als Deutscher und Koreaner. Das ist ihm während seines 15-monatigen Auslandsvikariats in Seoul, Korea, noch deutlicher geworden. Dort war er kein Fremder, auch wenn er die Sprache nicht perfekt beherrschte. Erstmals habe er gespürt, wie es sich anfühlt, in einem Land zu leben, „in dem alle so aussehen wie ich.“
Anders als in Korea oder auch in den USA spiele die Sprache hierzulande eine große Rolle. „In Deutschland werden Menschen nach ihrem Sprachvermögen klassifiziert.“ Manche Chancen gehen somit verloren, bedauert Jung. In den USA beispielsweise müsse ein Mensch seine Idee „rüber bringen“, also verständlich erklären können. Wie er das sprachlich macht, sei dabei nicht so entscheidend – anders in Deutschland. Hier sei sprachliche Ausdrucksfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Er habe manchmal den Eindruck, grammatikalische Korrektheit und Eloquenz gingen in Deutschland über alles. Damit würden viele Menschen ausgeschlossen.
Aber auch anders auszusehen als der Durchschnitt ist eine bleibende Herausforderung. Daniel nutzt das oft als Anknüpfungspunkt für Gespräche. Der junge Pfarrer hat einen persönlichen Traum: „Wenn der erste Koreaner für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt, dann wäre jedes Tor ein Siegtreffer.“

Fußball ist bereits ein Feld, in dem Interkulturalität bis zur Weltmeisterschaft gelebt wird. Zugleich wurde bei der Weltmeisterschaft 2018 in der Debatte um den ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil spürbar, wie zerbrechlich die interkulturelle Kommunikation in unserer Gesellschaft immer noch ist.
Migration gehört zu den Grundkonstanten menschlicher Geschichte, sie war und ist ein weltweites Phänomen. In fast allen Ländern der Erde finden Zu- und Abwanderungen statt. Freilich ist die internationale Migration gegenwärtig besonders hoch. Davon wird gesprochen, wenn Menschen für mehr als zwölf Monate in ein anderes Land ziehen, nur diese werden in den internationalen Statistiken erfasst. Die internationale Migration ist von 173 Millionen im Jahr 2000 über 222 Millionen 2010 bis zu 278 Millionen im Jahr 2017 kontinuierlich gestiegen. Viele Migrantinnen und Migranten gehen nicht freiwillig, sondern sehen sich gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Ende 2015 waren 63,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Armut. Das waren so viele wie nie zuvor. Die meisten von ihnen finden Zuflucht in Nachbarländern, 90 Prozent in Entwicklungsländern.
Die Trennlinie zwischen Migration und Flucht ist nicht immer eindeutig. Dennoch ist sie von Bedeutung. Flüchtlinge sind eine besonders schutzbedürftige Gruppe von Migranten, die aufgrund politischer, religiöser oder ethnischer Verfolgung sowie wegen andauernder Kriegshandlungen fliehen müssen. Die meisten fliehen in Nachbarländer. Gegenwärtig sind dies vor allem der Libanon, Jordanien und Kenia, deren Infrastruktur durch die hohe Zahl von Flüchtlingen überfordert ist. Daneben sind Menschen häufig aus Not zur Migration gezwungen. Rahmenbedingungen wie ein drastisches Wohlstandsgefälle, ökologische Krisen oder andere Ereignisse schaffen die Bedingungen und das Umfeld, in dem Menschen Entscheidungen zum Gehen oder Bleiben treffen. Die Entwicklung moderner Kommunikations- und Transportmittel erleichtert es, den Entschluss zur Migration, wenn er erst gefasst ist, schnell in die Tat umzusetzen.
Solche Ereignisse lassen sich zu allen Zeiten weltweit beobachten. Als eine frühe Form der Asylpolitik kann zum Beispiel die Aufnahme von reformierten Flüchtlingen am Niederrhein im 16. Jahrhundert oder die der Hugenotten verstanden werden, die als französische Protestanten im 17. Jahrhundert von deutschen Fürsten vor allem im Saarland und rund um Berlin als Glaubensflüchtlinge aufgenommen wurden.
Eine Antwort auf „2.1 Länderspiel der Herzen“
Schreiben Sie einen Kommentar
2.2 Deutschland als eine von Migration geprägte Gesellschaft
Ü B E R B L I C K
Pizza vom Italiener, Döner vom Türken, Lumpia vom Chinesen, Wodka aus Polen und Russland. Wenn es ums Essen und Trinken geht, sind wir offen für vieles. International, multikulturell ist Deutschland nach 1945 geworden, als die ersten Vertriebenen und Flüchtlinge ankamen und später die „Gastarbeiter“ geholt wurden. Offen ist die Gesellschaft jedoch noch lange nicht in allen Bereichen…
Auch viele Deutsche wurden durch Kriege, Glaubenskonflikte, Hungersnöte, politische Missstände und soziale Perspektivlosigkeit gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Mit der Gründung der ersten europäischen Kolonien setzte um 1700 die Auswanderung über den Atlantik ein. Nach der preußischen Union 1817 suchten strenge Lutheraner als Glaubensflüchtlinge Religionsfreiheit in Übersee. Zwischen 1816 und 1914 wanderten fast sechs Millionen Deutsche in die USA, nach Kanada, Brasilien oder Australien aus, um für sich und ihre Kinder bessere Lebensbedingungen zu erarbeiten.
Mit Beginn der Hochphase der Industrialisierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Deutsche Reich zu einem der weltweit wichtigsten Einwanderungsländer. Arbeitskräfte aus Südeuropa, vor allem aber aus den ländlichen Regionen Ostpreußens, insbesondere Polens und Masurens, wanderten innerhalb des Deutschen Reichs in die damaligen „Boomregionen“ der Wirtschaft, vorwiegend ins Ruhrgebiet. Darüber hinaus wurden 1914 etwa 1,2 Millionen ausländische Wanderarbeiter im Deutschen Reich gezählt.
Verfolgung, Vertreibung und Flucht prägten das Migrationsgeschehen im Zuge der beiden Weltkriege. Der Völkermord an den europäischen Juden, den in Deutschland nur 34.000 überlebten, ist auch heute noch Mahnung für eine offene und tolerante Gesellschaft.
Besonders prägend für die deutsche Gesellschaft waren die Jahre des so genannten Wirtschaftswunders. Aufgrund der Arbeitsmöglichkeiten in der Industrie kamen nach ihrer Flucht aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und aus der DDR viele Menschen nach Nordrhein-Westfalen (NRW), 17 Prozent der Bewohner Nordrhein-Westfalens gehörten 1961 zu dieser Gruppe. Eine geregelte Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte – vor allem aus Südeuropa, der Türkei und aus Nordafrika – erfolgte ab 1955, weil der Bergbau, die Schwerindustrie und die industrielle Massenfertigung einen großen Bedarf an Arbeitskräften hatten. Es fanden also verschiedene Migrationsformen und -bewegungen statt: NRW war „in Bewegung“.
Endlich ist in der unteren Einkaufszone wieder etwas los. Es gibt viele kleine Läden und Lokale und keine blöden Spielhallen mehr. Ich gehe gerne in den kleinen syrischen Lebensmittelladen. Die Leute sind dort so freundlich.
Frau, 48 Jahre
Trotz des Anwerbestopps und einer zunehmend restriktiven Migrationspolitik ab 1973 blieben viele ausländische Arbeitsmigranten – sie wurden als „Gastarbeiter“ bezeichnet, was ihren zeitlich begrenzten Aufenthaltsstatus deutlich machen sollte – in Deutschland und versuchten sich zu integrieren. Unterstützung erhielten sie dabei vor allem durch Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Vereine und am Arbeitsplatz, eine staatlich gewollte und geförderte Integrationspolitik aber gab es für diese Gruppe von Migranten und Migrantinnen nicht.
Anders verlief der Zuzug deutschstämmiger Migrantinnen und Migranten. Ab 1953 regelte das Bundesvertriebenengesetz die Aufnahme von Russlanddeutschen als Aussiedler, denen die deutsche Staatsbürgerschaft zustand. Seit den 1960er Jahren siedelten viele Nachfahren der im 18. Jahrhundert unter Katharina der Großen angeworbenen deutschen Siedler in die Bundesrepublik um. In den 1980er Jahren und besonders nach dem Zerfall der Sowjetunion wuchs die Zuwanderung der Aussiedler stark an. Zwischen 1992 und 2015 kamen mehr als 1,8 Millionen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Da mehr als 50 Prozent der Aussiedler und Spätausgesiedelten aus der ehemaligen UdSSR evangelisch sind, kam es zu einer großen Einwanderung in unsere Kirche. Die Evangelische Kirche von Westfalen hat dadurch etwa 280.000 neue Gemeindeglieder aufgenommen, das sind gegenwärtig mehr als 10 Prozent ihrer Mitglieder.
Als Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre die Zahl der Asylsuchenden vor allem als Folge der Balkankriege stark anwuchs, gipfelte die politische Debatte im sogenannten „Asylkompromiss“: Dieser ermöglichte die Abschiebung von Asylbewerbern in einen sogenannten „sicheren Drittstaat“. Personen im Status einer Duldung wurden weitgehend von integrationsfördernden Maßnahmen und vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. In dieser Zeit gewannen die „Kirchenasyle“ als Reaktion auf ungelöste menschenrechtliche Probleme des deutschen Asylrechts eine zunehmende Bedeutung.
2005 erfolgte mit der Einführung des Zuwanderungsgesetzes eine Anpassung der deutschen Gesetzeslage an europäische Vorgaben. So öffnete beispielsweise die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union den Arbeitsmarkt für EU-Bürgerinnen und -Bürger. Nach wie vor stammen die meisten Zuwanderer in Nordrhein-Westfalen (NRW) aus Polen. Aber auch der Anteil an Rumänen und Bulgaren ist im Zuge der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit gestiegen. Da deren sozialrechtlicher Status problematisch ist, führte das oft zu bisher unbewältigten sozialen Problemen. Seit der internationalen Finanzkrise 2007/08 ist erneut die Zuwanderung aus Italien, Spanien und Griechenland angestiegen. Zumeist finden diese Migranten recht schnell einen Arbeitsplatz.
Seit einigen Jahren hat erneut die Zuwanderung aus Bürgerkriegsgebieten wie beispielsweise Syrien deutlich zugenommen. Durch Verfolgung, Flucht, Kriege und Hungersnöte ist die Zahl der Asylsuchenden in NRW in den Jahren 2015 und 2016 auf mehr als 300.000 gewachsen. Seit dem Jahr 2017 sinkt die Zahl der Asylsuchenden.
Sie kamen als Geflüchtete und fanden hier Wohnung
Ich wohne in der Nähe der Universität. Im Wohnheim gegenüber leben Menschen vieler Nationalitäten und Hautfarben. Sie steigen mit mir in die Straßenbahn und geben mir das Gefühl, in einer Weltstadt zu leben. Mit uns fahren Menschen, die in zweiter und dritter Generation im Stadtviertel leben. Sie kamen als Geflüchtete und fanden hier Wohnung und freundliche Aufnahme. Meine Kirchengemeinde bot mehrfach Kirchenasyl. Sie betreibt eine soziale Stadtteilarbeit mit Hausaufgabenhilfe und Beratungsangeboten. Zusammen mit der katholischen Nachbargemeinde lässt sich immer eine Bleibe finden, auch wenn der Wohnungsmarkt es nicht herzugeben scheint. Ich genieße den bunten Mix beim Einkaufen, Menschen mit Kopftuch und Turban, weiten Hosen und langen Kleidern, die untereinander viele Sprachen sprechen, mit mir aber immer deutsch.
Ghettobildung und Verrohung
Regelmäßig einmal in der Woche fahre ich in den gegenüberliegenden Teil der Stadt. Dann steige ich in der Stadtmitte in eine andere Linie der Straßenbahn um. Auch dort fahre ich mit Menschen, die vor einer oder zwei Generationen aus fernen Ländern kamen. Sie wurden in einem Stadtviertel wie in einem Ghetto angesiedelt, Menschen aus mehr als 60 Ländern, von ihrer Herkunft her zum Teil einander seit Generationen feindlich gesinnt. In dieser Bahn ist es meistens laut, junge Männer erzählen einander stolz, wie sie wieder einen „Bullen“ ausgetrickst haben. Lautstark telefonieren sie nach einem Kumpel („Hey, Alter!“), der dazukommen soll, um Ali fertigzumachen, zu dem sie unterwegs sind. Unverhohlen wird auch mal das neue Messer aus dem Wadenstrumpf gezogen und stolz herumgezeigt. Spät in der Nacht fühle ich mich nicht immer wohl in dieser Bahn und bin froh, wenn ich sie in der Stadtmitte wechseln kann.
Frau, 75 Jahre
Die Debatte über die Herausforderung der Zuwanderung hat seither an Schärfe zugenommen. In oft problematischer Weise, zum Teil mit fremdenfeindlichen und rassistischen Motiven verknüpft, werden zunehmend Fragen der nationalen Identität diskutiert.
Mit gezielten Tabubrüchen wird in Frage gestellt, dass die Würde eines jeden Menschen unabhängig von Herkunft und ethnischer Zugehörigkeit unantastbar ist.
Die Gruppe derjenigen, die Zuwanderern und damit einer wachsenden Vielfalt eher skeptisch bis ablehnend gegenübersteht, ist nicht einheitlich.
Ich gehe durch die untere Einkaufsstraße unserer Stadt und sehe kein einziges deutsches Geschäft. Nur fremde Läden, komische Lokale, fremde Gerüche und eine fremde Sprache. Ich sehe auch keine Deutschen hier. Wo leben wir?
Mann, 70 Jahre
Neben Menschen am Rande der Gesellschaft finden sich auch hier Frauen und Männer, die aufgrund ihres konservativen Wertegerüsts gesellschaftlicher Vielfalt gegenüber skeptisch sind. Diese Gruppe ist jedoch interessiert an politischen Diskursen. Auf der anderen Seite stehen Vertreter einer grundsätzlich antipluralen Wertehaltung, die betont national oder sogar nationalistisch denken und das Ideal einer scheinbar „homogenen“ Bevölkerung proklamieren.
In der AfD finden sich Vertreter dieser verschiedenen Richtungen, wobei die national oder nationalistisch denkende Gruppe den medialen Auftritt der Partei immer stärker prägt und zu rechtsextremen Positionen neigt.
Diese Unterschiede machen deutlich, dass der Umgang mit der rechtspopulistischen Herausforderung auf verschiedenen Wegen erfolgen muss.
2 Antworten auf „2.2 Deutschland als eine von Migration geprägte Gesellschaft“
-
In dem Abschnitt wird der Teil der Spätaussiedler auf das Herkunftsland Russland doch sehr verengt dargestellt. Insbesondere Polen ist neben anderen doch ein wichtiges Herkunftsland.
Mir war nicht bewusst, dass der Anteil der aus Russland stammenden Spätaussiedler 10 % in unseren Gemeinden ausmacht. Mein Eindruck: diese finden sich vielleicht noch in den Gottesdiensten wieder, kaum jedoch in den Leitungsstrukturen unserer Kirche. Interessant wäre auch zu schauen, an welchen Stellen sie in der Mitarbeitendenschaft zu finden sind. -
Mich selbst gäbe es nicht, wenn sich nicht vor einigen Jahrhunderten bzw. Jahrzehnten ein Teil meiner Vorfahren aufgrund Glaubensverfolgung (Hugenotten) oder Arbeitsmigration (Österreich) auf den Weg nach „Deutschland“ gemacht hätten. Und im 19. Jh. wanderte ein Teil meiner Vorfahren nach Amerika aus, weil sie als Weber dem Hunger und der Perspektivlosigkeit entfliehen wollten. Migration und Integration geschehen zu allen Zeiten, eben auch heute. Und das müssen wir aktiv angehen und nicht bejammern.
Schreiben Sie einen Kommentar
2.3 Wachsende Vielfalt gestalten – eine Aufgabe der Religionen
Ü B E R B L I C K
Muslime, Juden, Hindus, Buddhisten, Jesiden, Aleviten, Bahai, Sikhs und andere Gläubige leben bei uns. Viele Moscheen prägen durch ihre Minarette inzwischen das Stadtbild sichtbar mit. Konfessionen und Religionen sind mehr denn je gefragt, das Miteinander zu gestalten…
Angekommen in der neuen Heimat: Moscheebau als sichtbares Zeichen
Der Moscheeverein Dortmund-Hörde, hervorgegangen aus dem türkisch-islamischen Kulturverein, betrieb seit 1982 in einem umgebauten Wohnhaus gegenüber dem Stahlwerk eine sogenannte Hinterhofmoschee. Mit der zunehmenden Integration der türkischen Zuwanderer entstand der Wunsch, dem Heimatgefühl auch religiös einen sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Der Moscheeverein nahm 2003 Gespräche mit der Stadtverwaltung auf und suchte nach einem geeigneten Gelände im Stadtteil. Mit der Brachfläche am Grimmelsiepen war dieses schnell gefunden.
Als die Pläne öffentlich wurden, begann in der Bürgerschaft eine intensive Debatte. Geprägt durch die Ereignisse des 11. September 2001, verlief sie in aufgeheizter Stimmung. Es gründete sich eine Bürgerinitiative, die Unterschriften gegen den Moscheebau sammelte. Die evangelische Kirchengemeinde lud Politik, Kirchenkreis, katholische Kirchengemeinde und Moscheeverein zu einem Runden Tisch Grimmelsiepen ein. Das städtische Planungsdezernat veranstaltete Bürgerabende, zu denen über 250 Menschen kamen und sehr emotional miteinander diskutierten.
Die Muslime fühlten sich angegriffen und vielfach unter Generalverdacht gestellt, was sie sehr verletzte. Sie verstanden nicht, warum ihnen von Seiten der deutschen Bevölkerung auf einmal Misstrauen und Angst entgegenschlugen, lebten sie doch zum Teil schon seit Jahrzehnten in Hörde und fühlten sich nicht als Fremde.
Als Neonazis 2004 bundesweit zu zwei Demonstrationen gegen den Moscheebau in Hörde mobilisierten, brachte das die Bürgerschaft zusammen. Die Hörder distanzierten sich von den Nazi-Aufrufen und organisierten schließlich Hand in Hand mit dem Moscheeverein eine Gegendemonstration mit über 1000 Teilnehmenden. Muslime hatten für diese Demonstration Plakate mit der Aufschrift gedruckt: „Mein Zuhause ist Hörde. Habe kein anderes.“ und „Keine Fremden. Seit 40 Jahren Mitbürger.“
Während der Protest weiterging, entwickelte sich auch die Diskussion um den Bebauungsplan. Schließlich wurde mit den Stimmen von SPD und CDU mit Hinweis auf die Religionsfreiheit der Moscheebau genehmigt.
Seitdem die Moschee fertiggestellt ist, sind die Proteste einem großen Interesse an Moscheeführungen gewichen – gerade aus der Nachbarschaft. Viele Besucherinnen und Besucher zeigen sich stark beeindruckt von dem repräsentativen Gebäude, in das Neugierige auch von außen hineinschauen können, da für die Fenster Klarglasscheiben verwandt wurden. Die Moschee ist ein Aushängeschild für den Stadtteil. Besonders die Tatsache, dass sie komplett aus Spendenmitteln finanziert wurde, nötigt den meisten Besuchern Respekt ab.
Was noch fehlt, ist das Minarett. Vorsorglich hat die Stadt schon einen Vertrag mit der Moscheegemeinde geschlossen, in dem die Dezibel-Zahl geregelt und festgelegt ist, dass der Ezanruf (Gebetsruf) nur einmal in der Woche zum Freitagsgebet erschallen darf.
Migration führt zu wachsender gesellschaftlicher Vielfalt (Pluralität), nicht zuletzt im Blick auf Religionen und Glaubensgemeinschaften. Mehr Vielfalt bereichert und stellt die Gesellschaft zugleich vor Herausforderungen, denn Migrantinnen und Migranten bringen andere Wertvorstellungen sowie ihre kulturellen und religiösen Prägungen mit.
Für Migrantinnen und Migranten besteht die umgekehrte Herausforderung: Auch die Glaubens- und Wertvorstellungen aus der eigenen Kultur werden in einer pluralen Gesellschaft zu einer Option unter vielen. Sie müssen mit den Regeln der individuellen Selbstbestimmung und Gleichberechtigung vereinbar sein, wie sie die freiheitliche demokratische Verfassung setzt.
Die Religionen und Religionsgemeinschaften sind herausgefordert und gefragt, wie sie das Mit- und Nebeneinander ihrer Glaubens-, Lebens-, Welt- und Gottesauffassungen verstehen und vor Ort gestalten. Es gilt, auskunftsfähig zu werden über das Eigene und dabei über die verbindenden, aber auch die trennenden Wahrheitsansprüche in einen Austausch zu treten.
Der religionsneutrale Staat sucht nach tragfähigen Bedingungen und Möglichkeiten, die im Grundsatz religionsfreundliche deutsche Rechtsordnung für unterschiedliche Religionsgemeinschaften weiterzuentwickeln. Gleichzeitig werden in der Gesellschaft zunehmend Stimmen laut, die angesichts religiöser Gewalt deutliche Vorbehalte gegenüber einer öffentlichen Präsenz der Religionen äußern. Ausgrenzung religiösen Lebens aus der Öffentlichkeit unter dem Vorwand einer vermeintlichen Neutralität kann in einem freiheitlichen Rechtsstaat keine Lösung sein. Die Religionen müssen allerdings auch ihren Beitrag für ein friedliches Zusammenleben deutlich machen, um auf diese Weise mit ihren Wertgrundlagen Orientierung zu geben.
Auch im Blick auf den christlichen Glauben zeigt sich der Prozess der Pluralisierung. Und zwar in einer wachsenden Vielfalt von Konfessionen. Diese Entwicklung ist vergleichsweise neu. Seit den Konfessionskriegen der Reformationszeit bestand Deutschland zumeist aus religiös-konfessionell einheitlichen Regionen. Größere Veränderungen brachten – etwa im Ruhrgebiet – die Arbeitsmigration in der Zeit der Industrialisierung und sodann die Flucht- und Vertreibungsgeschichte am Ende des Zweiten Weltkriegs.
Die Gegenwart ist geprägt von freundschaftlicher Nähe und partnerschaftlichem Miteinander zwischen den großen Volkskirchen und kleineren Kirchen und Freikirchen anderer Konfession. Im Zuge der gegenwärtigen Migrationsbewegungen kommen Menschen mit weiteren konfessionellen und kulturellen Prägungen zu uns. Die Migrantinnen und Migranten erleben die religiöse Gemeinschaft und die Feier des Glaubens in ihrer Sprache, ihren gottesdienstlichen und musikalischen Traditionen als eine Kraftquelle, als geistliche Heimat. Zugleich suchen sie die Begegnung mit dem Leben der länger ortsansässigen Gemeinden und die Teilhabe daran.
Schreiben Sie einen Kommentar
2.4 Wege der Integration eröffnen
Ü B E R B L I C K
Was heißt Integration? Einfache Antworten gibt es darauf nicht. Sich anpassen an neue Lebensbedingungen, heißt es oft. Doch schwierig ist es dabei für Menschen anderer Herkunft, die eigene Kultur, den eigenen Glauben, weiter beizubehalten. Dabei kann das sehr bereichernd sein…
Migrationsgesellschaften müssen Bedingungen gestalten, unter denen Integration gelingen kann. Dies ist eine Schlüsselaufgabe. Sie ist in Deutschland lange Zeit ignoriert worden, zum Nachteil aller, der Zugewanderten wie der Aufnahmegesellschaft. Erst seit dem Jahr 2007 besteht ein nationaler Integrationsplan, seit 2008 wird über die Fortschritte (und Rückschritte) von Integration berichtet.
Der Begriff der Integration wird wie selbstverständlich verwendet. Dabei ist oft unklar, was damit gemeint ist. Welche Erwartungen werden an wen gerichtet? Im Kern versteht man unter Integration einen wechselseitigen Prozess, der allen die gleichen Chancen eröffnet, an den gesellschaftlichen Grundgütern teilzuhaben (Recht, Bildung, Gesundheit, soziale Absicherung). Integration bedeutet somit keine einseitige Anpassung der Zugewanderten, keine Assimilation, sondern Einbeziehung und Teilhabe aller. In diesem Sinn benötigt Integration wechselseitige Begegnungsgeschichten, wie sie vielfach durch lokale Bindungen an den „eigenen“ Stadtteil, die „eigene“ Stadt oder auch den lokalen Sportverein ermöglicht werden. Integration wächst am besten „von unten“ her, durch gemeinsame Erfahrungen in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, nicht zuletzt in den Kirchen- oder Religionsgemeinschaften „vor Ort“.
In meiner Mittelstandsfunktion habe ich mich immer für den Dialog eingesetzt und türkische Unternehmer aufgefordert, in unseren Gremien mitzuarbeiten. Für die Integration ist aber entscheidend, was in den Moscheen passiert. Muslime gehören zu Deutschland, keine Frage. Aber der Islam kennt keine Trennung zwischen Kirche und Staat. Diese Trennung ist für unser Grundgesetz grundlegend. Die Frage muss also erlaubt sein, ob ein ideologischer Islam zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung passt. Ich halte den Islam in Deutschland nicht für integrationsfähig. Jedenfalls erlebe ich ihn zur Zeit eher als Integrationsverhindernd denn als fördernd.
Friedhelm Müller, ehemaliger stellv. Vorsitzender CDU Mittelstandsvereinigung NRW, Gründungsmitglied des deutsch-türkischen Forums
Vor dem Hintergrund, dass wir sowohl in einer Moschee, als auch in einer Kirche gemeinsam beten, tritt die Frage nach demselben Gott in den Hintergrund. Dass wir gemeinsam beten und gemeinsam diakonisch handeln, ist die Praxis des Glaubens.
Agim Ibishi, Sozialarbeiter, Muslim und Mitarbeiter des Diakonischen Werkes im Evangelischen Kirchenkreis Herford
Auf einer weiteren Ebene unterscheidet man individuelle und strukturelle Integration. Individuell wird der Grad der Integration an Erfolgskriterien bei Bildung (insbesondere Spracherwerb), Beruf und Einkommen gemessen und meint eine angemessene Teilhabe an den wirtschaftlichen Möglichkeiten der Aufnahmegesellschaft. Strukturelle Integration bezieht sich dagegen auf die Übernahme von Grundwerten der Aufnahmegesellschaft und meint die Akzeptanz grundlegender Regeln der Mehrheitskultur. Dies ist politisch nicht unumstritten, beschreibt aber nichtsdestotrotz einen wesentlichen Aspekt von Integration. Die Grundwerte der bundesdeutschen Gesellschaft sind an den menschenrechtlichen Normen der Grundartikel des Grundgesetzes (Artikel 1–20) orientiert, die nicht zur Disposition stehen und von Migrantinnen und Migranten, wenn sie in Deutschland heimisch werden wollen, im Grundsatz akzeptiert werden müssen. Diese Normen stehen historisch und sachlich in einem engen Zusammenhang mit christlichen Grundsätzen, können aber auch von Menschen anderer Religionen und Weltanschauungen nachvollzogen und akzeptiert werden. Darüber hinaus sind bestimmte kulturelle Grundhaltungen unserer Gesellschaft zu respektieren. Dazu gehört etwa der vom Christentum bestimmte Zeit- und Festrhythmus im Jahreszyklus, der trotz vieler Säkularisierungstendenzen im Blick auf den arbeitsfreien Sonntag oder die Oster- und Weihnachtszeit unsere Kultur nach wie vor wesentlich bestimmt. Des Weiteren sind grundlegende historische Erfahrungen der jüngeren deutschen Geschichte prägend, insbesondere die Kultur der Erinnerung an den Holocaust mit den Konsequenzen der Absage an jede Form von Antisemitismus und der Anerkennung des Existenzrechtes des Staates Israel.
Dass auf der anderen Seite viele Menschen mit Migrationsgeschichte die Sprache und Kultur ihrer familiären Herkunft pflegen, steht zu der Form struktureller Integration nicht in einem Widerspruch, sondern kann im Sinn einer schrittweisen Integration geradezu förderlich sein.
Die Pflege von Traditionen der Herkunftsgeschichte ist für viele Zugewanderte eine wichtige Ressource, die sie im Übergang zwischen den Kulturen stärkt. Sie kann aber auch die Aufnahmegesellschaft bereichern.
Ich verstehe vieles in ihrer (arabischen) Kultur nicht, aber die Menschen sind einfach nett und so etwas von freundlich.
Mann, 42 Jahre
Die Pflege der Herkunftskultur sollte daher nicht als Konkurrenz zur Einbindung in die Aufnahmegesellschaft beurteilt werden, sondern als natürliche Ergänzung.
Zusammengefasst heißt dies, dass Integration ein wechselseitiges Geschehen zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten bedeutet. Dies schließt die Akzeptanz grundlegender Regeln der Aufnahmegesellschaft, die Pflege von Migrationstraditionen und wechselseitige Lernprozesse ein. Integration ist insofern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die den koordinierten Einsatz von Förderungsmaßnahmen und eine interkulturelle Öffnung staatlicher und zivilgesellschaftlicher – nicht zuletzt religiöser – Institutionen voraussetzt. Dies verlangt vor allem Maßnahmen, um die Chancengleichheit durchzusetzen und zu sichern. Zugewanderte Menschen sind nicht nur Objekte staatlicher Fürsorge, sondern selbstbewusste Subjekte des gesellschaftlichen Wandels. Migrantenorganisationen sind daher wichtige Partner, um die nötigen Schritte zur gesellschaftlichen Integration gemeinsam zu definieren und umzusetzen. Die Teilhabe aller ist sowohl der Weg wie auch das Ziel einer so verstandenen Integration.
5 Antworten auf „2.4 Wege der Integration eröffnen“
-
Ich halte den Begriff Integration für gefährlich, da er zu oft mit Assimilation verwechselt wird.
Ich bevorzuge auch hier den Begriff der Inklusion – als Zeichen vorbehaltloser Aufnahme in die Gemeinschaft. Die Herausforderung das Miteinander gedeihlich zu gestalten bleibt. -
Ja, der Begriff „Integration“ ist widersprüchlich und wird in einem weiter Verständnis genutzt. Auch Verwechslungen sind nicht ausgeschlossen bei der Fülle und Dichtheit der Verwendungen.
Ob „Inklusion“ da jedoch eine Alternative ist, wage ich zu bezweifeln, ist der Begriff doch ebenso schillernd. Auch kann ein einzelner Begriff nicht immer das wiedergeben, was wir meinen.
Wir kommen nicht drumherum: Wir müssen immer wieder uns und unsere Intentionen erklären, genau und verständlich. Das braucht Kraft und Zeit, ist es aber wert. -
Grundlage für Integration schaffen:
– Sprachliche Fähigkeiten fördern
– Kontakte herstellen, z.B. Familienzentren, HOTs
– Personen mit Migrationshintergrund zur Mitarbeit/ Zusammenarbeit gewinnen. Stewart „Integrationslotse“
– Begleitung von Zugewanderten bei notwendigen BehördengängenFragen:
* Warten auf Integrationswillige ODER Zugehen auf die Personen? -
Integration: Dazu gehört auch der Integrationswille der Migranten. Professionelle Begleitung ist auf beiden Seiten nötig, aber gesellschaftlich höchst unterschiedlich.
Bereitschaft zur Integration muss von beiden Seiten gleich gewollt sein.
Integration ist eine Daueraufgabe.
Ressourcen sind notwendig für die Gemeinden und Unterstützung und Fortbildung, auch hauptamtliche Unterstützung; z.B.: „Parolen Paroli bieten“Der Überforderung entgegenwirken, auch durch Fortbildungen
-
Springt der Vorlagentext theologisch nicht zur kurz? Nach den furiosen Feiern des Reformationsjubiläums 2017 scheinen die theologischen Grunderkenntnisse der Reformation in der Hauptvorlage keine bedeutsame Rolle mehr zu spielen.
In theologischer Hinsicht verzichtet die Vorlage im Kontext der Migrationsdebatte darauf, das fundamentale Problem der zerrissenen Identität des Menschen zu beleuchten, das in der lutherischen Rechtfertigungslehre den zentralen Startpunkt der Aufdeckung der Selbstentfremdung des Menschen vor Gott ausmacht und die erlösende göttliche Gnadenzusage als eschatologische Befreiungsperspektive verheißt.
Bereits im Vorwort mit der Kopplung an eine „kräftige Provokation, diese tiefe Verheißung“ wird eine normative Vorgabe unterstrichen, freilich ohne den Aspekt der ‚Provokation‘ zu vertiefen, wenn von „überraschenden und beglückenden Erfahrungen“ (ebd., 4) berichtet wird. Gegenstimmen, Zweifel, Distanznahmen oder Abweichungen kommen dagegen nur vereinzelt in den eingestreuten O-Tönen mit Statements zur Sprache und unterbrechen den laufenden Text. Keine dieser kontextbefreiten Aussagen wird inhaltlich politisch oder theologisch näher interpretiert; es kommt ihnen lediglich eine beiläufige, untermalende Funktion zu, um den Hauptanreiz zu stimulieren, eine bestimmte Sicht („Haltung“) einzunehmen, die generell von der unangefochtenen Absicht zur dauerhaften „Integration“ (ebd., 9) geprägt ist.
Wenn es in der EKvW-Vorlage heißt: „Immer mehr Menschen fühlen sich in unserer Gesellschaft abgehängt und ausgegrenzt. Manche von ihnen empfinden Migrantinnen und Migranten mit der Fähigkeit und dem Willen zum sozialen Aufstieg als Konkurrenten um Arbeitsplätze.“ (ebd. 8), werden „Schwierigkeiten“ bei der Integration als subjektives, emotionales Problem, einer empfundenen „Überforderung“ (ebd., 8) behandelt. Daher hält man Ausschau nach Ängsten, bei denen, die noch nicht so weit sind. Die Vorlage behandelt alle, die die Position des Textes nicht teilen, als „Ängstliche“ oder Besorgte, also unter dem Aspekt eines Defizits. Man darf erwarten, dass die damit beschrittene Asymmetrie nicht von allen Leserinnen und Lesern der Vorlage geteilt wird.
Obwohl das zweite Kapitel der Vorlage die Überschrift „sozialethischer Orientierung“ (ebd., 22) trägt, versäumt man die kritische Diskussion von Einwänden und Gegenpositionen; die Auseinandersetzung mit Materialien politischer Gegner wie der AfD oder „Frauen[n] und Männer[n], die aufgrund ihres konservativen Wertegerüsts gesellschaftlicher Vielfalt gegenüber skeptisch sind“ (ebd., 27) werden ausgeklammert. Stattdessen beschränkt man sich auf deren Etikettierung als „antiplural“, „betont national“ oder „nationalistisch“ (ebd., 27). Daher ist die argumentative oder analytische Orientierungsleistung des Textes dank der polarisierten Lesart gering. Näheres zu dieser Frage unter
In theologischer Hinsicht verzichtet die Vorlage im Kontext der Migrationsdebatte darauf, das fundamentale Problem der zerrissenen Identität des Menschen zu beleuchten, das in der lutherischen Rechtfertigungslehre den zentralen Startpunkt der Aufdeckung der Selbstentfremdung des Menschen vor Gott ausmacht und die erlösende göttliche Gnadenzusage als eschatologische Befreiungsperspektive verheißt.Bereits im Vorwort mit der Kopplung an eine „kräftige Provokation, diese tiefe Verheißung“ wird eine normative Vorgabe unterstrichen, freilich ohne den As\-pekt der ‚Provokation‘ zu vertiefen, wenn von „überraschenden und beglückenden Erfahrungen“ (ebd., 4) berichtet wird. Gegenstimmen, Zweifel, Distanznahmen oder Abweichungen kommen dagegen nur vereinzelt in den eingestreuten O-Tönen mit Statements zur Sprache und unterbrechen den laufenden Text. Keine dieser kontextbefreiten Aussagen wird inhaltlich politisch oder theologisch näher interpretiert; es kommt ihnen lediglich eine beiläufige, untermalende Funktion zu, um den Hauptanreiz zu stimulieren, eine bestimmte Sicht („Haltung“) einzunehmen, die generell von der unangefochtenen Absicht zur dauerhaften „Integration“ (ebd., 9) geprägt ist.
Wenn es in der EKvW-Vorlage heißt: „Immer mehr Menschen fühlen sich in unserer Gesellschaft abgehängt und ausgegrenzt. Manche von ihnen empfinden Migrantinnen und Migranten mit der Fähigkeit und dem Willen zum sozialen Aufstieg als Konkurrenten um Arbeitsplätze.“ (ebd. 8), werden „Schwierigkeiten“ bei der Integration als subjektives, emotionales Problem, einer empfundenen „Überforderung“ (ebd., 8) behandelt. Daher hält man Ausschau nach Ängsten, bei denen, die noch nicht so weit sind. Die Vorlage behandelt alle, die die Position des Textes nicht teilen, als „Ängstliche“ oder Besorgte, also unter dem Aspekt eines Defizits. Man darf erwarten, dass die damit beschrittene Asymmetrie nicht von allen Leserinnen und Lesern der Vorlage geteilt wird.
Obwohl das zweite Kapitel der Vorlage die Überschrift „sozialethischer Orientierung“ (ebd., 22) trägt, versäumt man die kritische Diskussion von Einwänden und Gegenpositionen; die Auseinandersetzung mit Materialien politischer Gegner wie der AfD oder „Frauen[n] und Männer[n], die aufgrund ihres konservativen Wertegerüsts gesellschaftlicher Vielfalt gegenüber skeptisch sind“ (ebd., 27) werden ausgeklammert. Stattdessen beschränkt man sich auf deren Etikettierung als „antiplural“, „betont national“ oder „nationalistisch“ (ebd., 27). Daher ist die argumentative oder analytische Orientierungsleistung des Textes dank der polarisierten Lesart gering. Näheres zu dieser Problematik in meinem ausführlicheren Text unter: https://bit.ly/34yPghH auf Seite 2 ff.



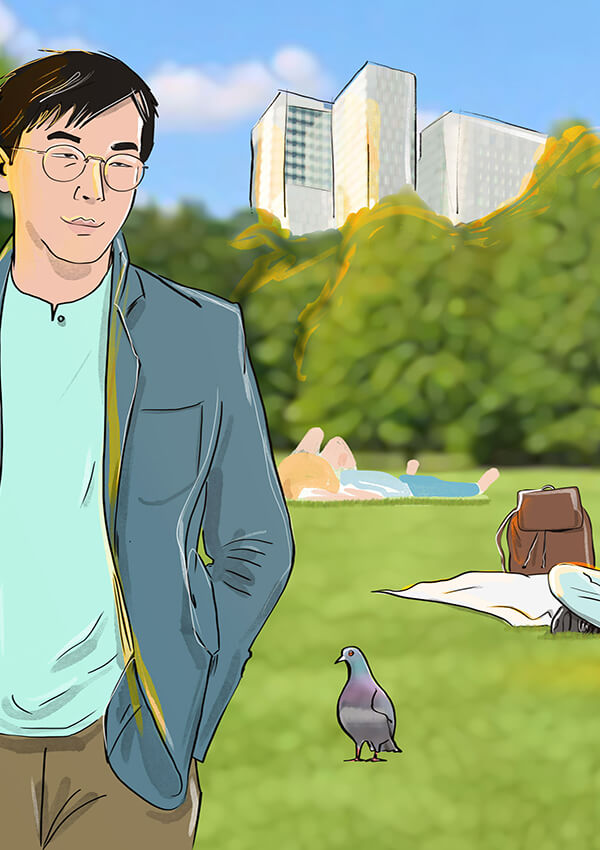


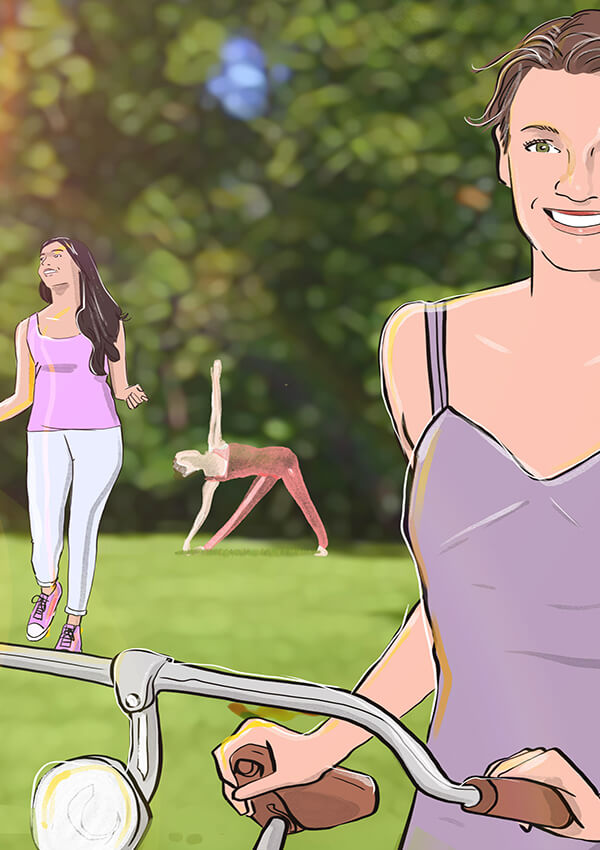





Tolles Video!